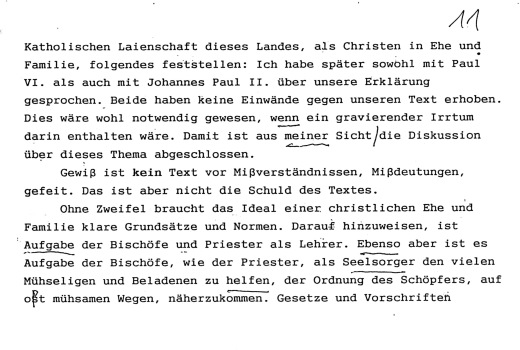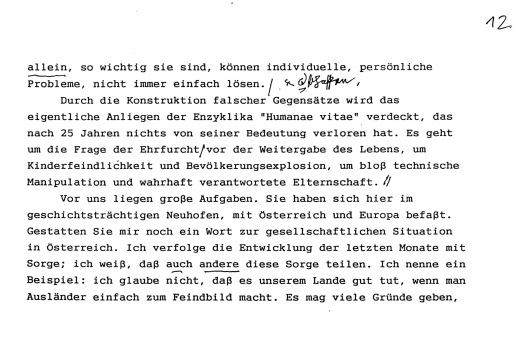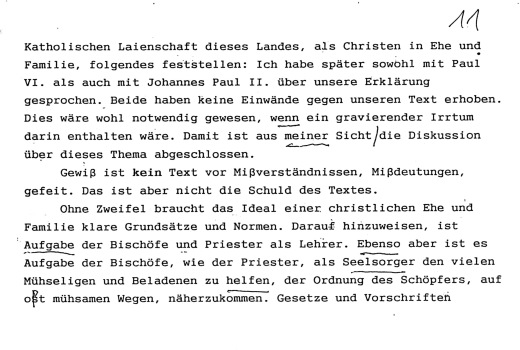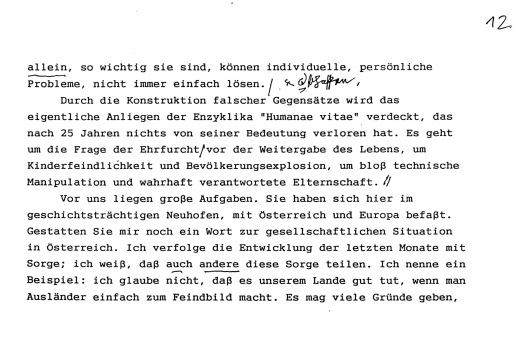FORUM OSTARRICHI 1993 des Katholischen Laienrates Österreichs

Im heutigen Sonntagsevangelium sind wir einem Satz begegnet, der eine fast sprichwörtliche Bedeutung erlangt hat: "Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert?" Dieser Satz hat eine starke Beziehung zu dem von Ihnen gewählten Generalthema: Was nützt der Aufbau eines wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch starken Europa, wenn diese dabei seine Seele verliert?
Stellen wir uns noch einmal die Frage, die Sie in den vergangenen Tagen wiederholt behandelt haben: Was ist die Seele Europas? Was sind die geistigen Grundlagen Europas, was sind die tragenden Ideen dieses Kontinents?
Wenn wir nur das Europa des 19. und 20. Jahrhunderts vor Augen haben, so hat der Kontinent ein doppeltes Antlitz. Auf der einen Seite steht das Ringen um die Freiheit, um Toleranz, um Achtung vor dem Leben, um Frieden; es geht um den gewaltigen wissenschaftlich-technischen Aufbruch, die vielen Errungenschaften, die das Leben der Menschen, nicht nur in Europa von Grund auf verändert haben. Andererseits geht es um die politischen Ideologien: des Nationalismus des 19. Jahrhunderts, des Nationalsozialismus und des Kommunismus im 20. Jahrhundert; sie alle haben unendliches Leid, Tod und Zerstörung über die Menschen gebracht.
Aber das europäische Bewusstsein reicht tiefer. Es reicht zurück in die Zeit eines Paulus, der Märtyrer im römischen Reich. Sie haben Europa eine christliche Seele gegeben. Das Christentum hat in der Folgezeit das Antlitz Europas geprägt; es war der Humus für die besten Früchte des europäischen Geistes. Der Heilige Benedikt hat durch seine Lebensordnung des "ora et labora" die christliche Prägung Europas für Generationen in der Folge festgelegt. Die vielen großen Frauen und Männer, nicht nur im Heiligenkalender, sondern ebenso auch in der Geschichte Europas, sind dafür Zeugen. Auf der Grundlage des Christentums wuchsen die Menschen des Römischen Reiches und die neuen Völker aus dem Norden und Osten zur europäischen Familie zusammen.
Gewiss, das alles ist Geschichte. Aber die geistigen Kräfte wirken weiter. Die Ideologien des 20. Jahrhunderts sind zusammengebrochen. Der Nationalismus des 19. Jahrhunderts taucht allerdings in unseren Tagen auf dem Balkan wieder auf und endet noch einmal in Tod und Tränen.
Insgesamt aber herrscht weiterhin Orientierungslosigkeit und Leere. Die Menschen des Kontinents sind im reichen Westen und im armen Osten Europas auf der Suche nach neuen Antworten auf ihre Fragen. Werden sie bei dieser Suche auch die christlichen Wurzeln Europas wiederentdecken?
Im Wortgottesdienst haben wir heute in der ersten Lesung die Stimme des Propheten Jeremias gehört, der in gewisser Weise auch die Unruhe des post-modernen Menschen ausdrückt: "Sagte ich aber", so der Prophet, "Ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen, so war es mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Inneren. Ich quälte mich, es auszuhalten, und konnte nicht". - Ist dieses Feuer, von dem der Prophet spricht, nicht in vielen Werken unserer zeitgenössischen Literatur und Kunst zu spüren? In Werken, wo die quälende Leere der Gottesferne zum Ausdruck kommt?
Auch wenn manche Strömungen der öffentlichen Meinung hierzulande es nicht wahrhaben wollen, wird auf der anderen Seite gerade wieder deutlich: Religion gehört zum Wesen des Menschen. Das Ahnen einer Abhängigkeit ist allerdings noch nicht gleichzusetzen mit christlichem Glauben. Aber überall, wo Menschen Spuren ihrer Geschichte hinterlassen haben, sind auch Spuren ihrer religiösen Einstellung zu finden.
Der Prozess der Säkularisierung ist allerdings schon lange bemüht, den Einfluss des Christentums, nicht aber der Religiosität im Allgemeinen, zurückzudrängen. Anhand der neuen europäischen Wertestudie ist wohl zu unterscheiden zwischen einer subjektiven Religiosität, nach eigenem Belieben zusammengebastelt und christlichem Glauben, mit allen seinen Konsequenzen. - Die neuen Sekten und neuen religiösen Bewegungen der letzten beiden Jahrzehnte versuchen ebenfalls, den Einfluss des Christentums zurückzudrängen.
Andererseits macht all dies doch wieder deutlich: Der Mensch sucht nach einem religiösen Weg, sucht eine Antwort auf letzte, tiefe Fragen: Woher komme ich, wohin gehe ich; welches ist das letzte, unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen?
Die Welt des Sichtbaren und des Habens, des Hier und Heute, kann solche Fragen nicht beantworten.
Die tiefste Wurzel der Antwort liegt in der Religion als Bindung an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Einer letzten Verantwortung ihm gegenüber kann sich niemand entziehen.
Nicht wenigen, die Verantwortung tragen, wird heute bewusst, dass wir an einer dramatischen Wende unserer Geschichte stehen: der Weg ohne Religion führt in eine Sackgasse des brutalen Egoismus, rücksichtsloser Triebe, im Namen einer Freiheit ohne Grenzen. Langsam setzt sich die Erkenntnis durch: Freiheit ohne Verantwortung, - für mich und für andere, - führt ins Chaos, zerstört letztlich die Freiheit des Menschen selbst.
Andererseits ist der Missbrauch der Religion, des christlichen Glaubens, im Dienste Wirtschaft und Politik, ebenso verderblich.
Die Situation ist insgesamt schwierig. Wie stellt sich nun die Kirche, wie stellen wir katholischen Christen uns einer solchen Situation? Einer Situation, die sich oft mit vagen Aussagen begnügt und sich vor Entscheidungen drückt?
Wenn heute gelegentlich behauptet wird, das II. Vatikanische Konzil sei schuld an verschiedenen Krisenerscheinungen in der Kirche, so ist festzuhalten:
Die Frage: "Für oder wider das Konzil" ist heute längst überholt. Nur Nachzügler melden sich noch zu Wort. Auf der Ebene der Weltkirche hat eine solche Diskussion keine Bedeutung mehr. Heute geht es um die Rezeption des Konzils.
Papst Johannes Paul II. sagte in seinem einleitenden Text zur Veröffentlichung des neuen Weltkatechismus: Wir müssen "unablässig" - ja, wörtlich: unablässig - auf die Quelle des Konzils zurückgreifen. - Wenn sich alle in der Kirche dieses Wort des Papstes zu Herzen nehmen, dann sollte es mit Gottes Hilfe gelingen, auch für die vielen suchenden Menschen unserer Zeit "Licht auf dem Berge" zu sein.
Die Kirche hat sich im II. Vatikanum mit prophetischem Blick für die Wende der Menschheitsgeschichte zugerüstet, die sich damals noch nicht so deutlich wie heute abzeichnete. Dieses Konzil hat den Weg der Kirche ins dritte Jahrtausend vorgezeichnet. Es ist der Weg einer Kirche, die im Vertrauen auf das Wort Christi mit den Menschen geht, sich ihre "Freude und Hoffnung", ihre "Trauer und Angst" zu eigen macht.
Das Konzil sieht in einer großen Vision die Kirche Christi als pilgerndes Gottesvolk aus Priestern und Laien. Es trägt mit die Verantwortung für eine Versöhnung der getrennten Christen. Es sieht die Kirche als "Zeichen der Einheit" unter den Völkern. Und dies in einer Welt, die um Einheit ringt, obwohl sie von immer größeren Gegensätzen zerrissen wird.
Wenn die Kirche, wenn wir durch die Kirche Vorbild sein sollen, dann sollten wir uns auch bemühen, dass innerhalb unserer Kirche weniger Angst und Unsicherheit vorherrscht. Wir brauchen mehr Gottvertrauen, mehr Hoffnung, mehr Freude; dann wird auch die Kraft der Überzeugung wirksam werden.
So habe ich es vor Kurzem in Taizé erlebt, wo junge Menschen aus allen Teilen Europas und anderen Kontinenten, dreimal täglich lange Zeit in Gesang und Gebet, mit der hl. Schrift, in Stille verharrten, - gemeinsam bei allem Respekt vor konfessionellen Verschiedenheiten. Dort versuchten sie, nationale und geschichtlich gewachsene Gegensätze zu überwinden, nicht zuletzt mit dem Blick auf ein neues Europa. Und dabei wurde in der Einfachheit des Lebens etwas von jenem neuen Pfingsten spürbar, das sich die Väter des II. Vatikanums erhofft hatten. Übrigens: Wo es begeisterte Christen gibt, dort wecken sie auch Begeisterung.
Wir haben auch in Österreich viele solcher spiritueller Brennpunkte: unsere Klöster, unsere Laienbewegungen, manche Pfarrgemeinden. Nützen wir diese Talente, die uns anvertraut sind, machen wir Türen, Fenster und Herzen weit auf, gehen wir hinaus zu den Menschen, die in Not sind, die Orientierung suchen, "freuen wir uns mit ihnen und trauern wir mit ihnen".
Die Zeit ist zu kostbar, als sie für überflüssige Diskussionen zu vergeuden. Wenn etwa 25 Jahre nach der Enzyklika "Humanae vitae" gesagt wird, die österreichischen Bischöfe hätten durch ihre damalige "Mariatroster Erklärung" vom September 1968 Verwirrung gestiftet, so möchte ich als damaliger Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz vor Ihnen, den Vertretern der Katholischen Laienschaft dieses Landes, als Christen in Ehe und Familie, folgendes feststellen: Ich habe später sowohl mit Paul VI. als auch mit Johannes Paul II. über unsere Erklärung gesprochen. Beide haben keine Einwände gegen unseren Text erhoben. Dies wäre wohl notwendig gewesen, wenn ein gravierender Irrtum darin enthalten wäre. Damit ist aus meiner Sicht die Diskussion über dieses Thema abgeschlossen.
Gewiss ist kein Text vor Missverständnissen, Missdeutungen, gefeit. Das ist aber nicht die Schuld des Textes.
Ohne Zweifel braucht das Ideal einer christlichen Ehe und Familie klare Grundsätze und Normen. Darauf hinzuweisen, ist Aufgabe der Bischöfe und Priester als Lehrer. Ebenso aber ist es Aufgabe der Bischöfe, wie der Priester, als Seelsorger den vielen Mühseligen und Beladenen zu helfen, der Ordnung des Schöpfers, auf oft mühsamen Wegen, näherzukommen. Gesetze und Vorschriften allein, so wichtig sie sind, können individuelle, persönliche Probleme nicht immer einfach lösen und aus der Welt schaffen.
Durch die Konstruktion falscher Gegensätze wird das eigentliche Anliegen der Enzyklika "Humanae vitae" verdeckt, das nach 25 Jahren nichts von seiner Bedeutung verloren hat. Es geht um die Frage der Ehrfurcht vor der Weitergabe des Lebens, um Kinderfeindlichkeit und Bevölkerungsexplosion, um bloß technische Manipulation und wahrhaft verantwortete Elternschaft.
Vor uns liegen große Aufgaben. Sie haben sich hier im geschichtsträchtigen Neuhofen, mit Österreich und Europa befasst. Gestatten Sie mir noch ein Wort zur gesellschaftlichen Situation in Österreich. Ich verfolge die Entwicklung der letzten Monate mit Sorge; ich weiß, dass auch andere diese Sorge teilen. Ich nenne ein Beispiel: ich glaube nicht, dass es unserem Lande guttut, wenn man Ausländer einfach zum Feindbild macht. Es mag viele Gründe geben, den Zuzug von Ausländern administrativ zu steuern. Doch keiner dieser Gründe ist gut genug, Unmenschlichkeiten zu rechtfertigen.
Gewiss, Österreich kann nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Aber es kann und sollte noch mehr in der Völkergemeinschaft dafür eintreten, dass jeder Staat seinen gerechten Teil dazu beiträgt, damit die Vertriebenen, die Flüchtlinge und erst recht die Verfolgten nicht ihrem Schicksal überlassen werden.
Gerade als katholische Christen sollten wir uns dabei in besonderer Weise um Offenheit und Toleranz bemühen gegenüber Menschen anderer Herkunft, anderer Kultur, anderer Sprache, anderer Traditionen und anderer Religionen. Auch das ist wichtig für eine Zukunft Europas über die gemeinsamen Wirtschaftsinteressen hinaus.
Angesichts solcher Fragestellungen muss aber auch in Erinnerung gerufen werden, dass das Verhältnis von Staat und Katholischer Kirche in Österreich mit gutem Grund nicht vom Gedanken der absoluten Trennung, sondern vom Prinzip der Partnerschaft geprägt ist. Denn Kirche und Staat dienen ja beide den selben Menschen. In vielen Bereichen des Lebens wirkt sich dieses Prinzip segensreich aus - zum Nutzen der Menschen, um die es geht.
Die Katholiken in Österreich werden sich nicht irremachen lassen. Weder durch Diskussionen um Äußerungen isolierter Stimmen noch durch die Rückkehr gewisser antiquierter antiklerikaler Vorstellungen.
Dabei geht es uns ja nicht um Macht und Einfluss. Die Aufgabe der Christen ist es nicht, "eine Rolle zu spielen". Vielmehr sollten sie die Funktion eines Sauerteiges haben, immer in Erwartung des "Reiches Gottes".
Das ist nicht nur ein subjektives religiöses Gefühl. Es geht um eine Geschichte auf dem Boden des Lebens und der Auferstehung Christi, eingewurzelt im Zeugnis der Apostel, der Märtyrer und Bekenner von zwei Jahrtausenden. Trotz aller Widerstände, auch unserer Zeit, bekennen wir den Glauben an den dreieinigen Gott, so wie es unsere Vorfahren getan haben. In diesem Glauben werden unsere Kinder getauft, unsere Ehen eingesegnet, unsere Priester geweiht, unsere Kirchen konsekriert, Sünden vergeben, die Kranken gesalbt, die Toten zur Ruhe bestattet. Unsere Kirche lebt in Gemeinschaft mit dem einen Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Daher verlassen wir uns auf das Jesuswort: "Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit; alles andere wird auch hinzugegeben werden!"